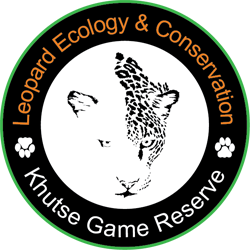Das Verständnis der Verfügbarkeit von Beutetieren steht im Zentrum unserer Naturschutzarbeit. Raubtiere wie Leoparden und Löwen leben nicht isoliert – ihr Überleben hängt direkt von der Anzahl und den Bewegungen der Beutetiere in ihrer Umgebung ab. Wenn die Bestände zurückgehen oder sich verlagern, verändert sich auch das Verhalten der Raubtiere. Sie passen ihre Jagdstrategien an, durchstreifen grössere Gebiete oder geraten vermehrt in Konflikt mit Vieh und Menschen. Indem wir die Verfügbarkeit von Beutetieren sorgfältig überwachen, können wir diese Muster besser verstehen und wichtige Informationen gewinnen, die für Naturschutzentscheide entscheidend sind.
Bei Leopard Ecology & Conservation nutzen wir zwei Hauptmethoden, um Beutetiere zu erfassen:
- Fotofallen-Erhebungen
- Spur- und Beutezählungen
Gemeinsam liefern diese Methoden sowohl detaillierte, kleinskalige Daten als auch einen breiteren Überblick auf Landschaftsebene. Sie zeigen uns nicht nur, wie viele Tiere vorhanden sind, sondern auch, wie sie ihren Lebensraum nutzen, wie sich ihre Bewegungen im Laufe der Jahreszeiten verändern und welchen Einfluss dies auf die Raubtiere hat, die wir erforschen.
Fotofallen-Erhebungen
Fotofallen sind eines unserer wichtigsten Werkzeuge. Es sind bewegungsgesteuerte Kameras, die in unserem gesamten Forschungsgebiet installiert werden und Tiere fotografieren, während sie sich ganz natürlich durch die Landschaft bewegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zählungen, die auf menschliche Beobachter angewiesen sind, arbeiten Fotofallen rund um die Uhr – sie liefern ein kontinuierliches und völlig störungsfreies Bild der Tierwelt.
Für unsere Forschung im Khutse Game Reserve und im südlichen Zentral-Kalahari haben wir ein grossflächiges Raster aus Kameras installiert, das mehr als 4’000 km² abdeckt.
Jede Station wird sorgfältig entlang von Wildwechseln, in der Nähe von Pfannen (Wasserlöchern) oder an Strassenquerungen platziert, wo Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeikommen. Manche Stationen sind mit nur einer Kamera ausgestattet, andere mit zwei Kameras, die sich gegenüberstehen, um beide Körperseiten eines Tieres aufzunehmen. Das ist besonders hilfreich, um einzelne Leoparden zu identifizieren – ihr Fellmuster ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.
Unsere Kameras nutzen Infrarotsensoren, um Bewegung und Körperwärme zu erkennen. Dadurch werden hochauflösende Fotos sowohl am Tag als auch in der Nacht ausgelöst. Nachts sorgen Blitzlichter dafür, dass die Tiere gut sichtbar sind – ganz ohne Köder oder Lockmittel. So zeigen die Bilder das natürliche Verhalten der Tiere.

Alle paar Wochen besucht unser Team jede Station, um Batterien auszutauschen, Speicherkarten zu wechseln und Details zum Lebensraum zu erfassen, zum Beispiel Vegetationsstruktur oder Nähe zu Wasser. Die Tausenden von aufgenommenen Bildern werden anschliessend mit Hilfe von KI-Tools wie TrapTagger ausgewertet und danach von unseren Forschern manuell überprüft.
Diese Kombination aus moderner Technologie und menschlicher Expertise garantiert, dass unsere Daten präzise und verlässlich sind. Bei diesen Erhebungen zählen wir nicht nur Leoparden, sondern erfassen auch die Anwesenheit, Häufigkeit und Aktivität ihrer Beutetiere. Von Antilopen und Warzenschweinen bis hin zu kleinen nachtaktiven Tieren – die Fotofallen geben ein umfassendes Bild der Beuteverfügbarkeit im Verlauf der Jahreszeiten.
Langfristig helfen uns diese Daten, entscheidende Fragen zu beantworten:
- Welche Beutetiere kommen in welchen Lebensräumen am häufigsten vor?
- Wie verändert sich das Beuteangebot vor und nach der Regenzeit?
- Passen Löwen und Leoparden ihre Ernährung an, wenn bestimmte Beutetiere knapp werden?
Indem wir diese Muster kontinuierlich überwachen, können wir ein immer klareres Bild vom empfindlichen Gleichgewicht zwischen Raubtier und Beute im Kalahari-Ökosystem zeichnen.



Warum es sich lohnt beide Methoden zu kombinieren
Jede Methode hat ihre eigenen Stärken. Fotofallen liefern eine kontinuierliche, langfristige Überwachung mit Bildbelegen, während Spur- und Beutezählungen grössere Flächen schneller abdecken und sofortige Ergebnisse liefern. Kombiniert ergeben sie das vollständigste Bild, das wir bekommen können.
Die Daten aus den Fotofallen können sogar dazu genutzt werden, die Ergebnisse der Spurenzählungen zu überprüfen – so stellen wir sicher, dass alles konsistent und genau ist. Zusammen helfen uns diese Ansätze nicht nur zu verstehen, wie viele Tiere vorhanden sind, sondern auch, wie sie miteinander interagieren, wann sie aktiv sind und wie sich diese Dynamiken mit den Jahreszeiten, dem Regen oder dem Einfluss der Menschen verändern.
Blick in die Zukunft
Auch wenn Fotofallen und Spurenzählungen heute das Rückgrat unserer Arbeit bilden, sucht LEC ständig nach neuen Wegen, die Beobachtung der Wildtiere weiter zu verbessern. In naher Zukunft wollen wir Zählflüge mit Kleinflugzeugen einsetzen, um grosse Gebiete schnell zu erfassen und so einen Überblick über die Beutetierherden in der gesamten Kalahari zu gewinnen.
Ausserdem prüfen wir den Einsatz von Wärmebild-Drohnen. Diese können Tiere anhand ihrer Wärmesignaturen erkennen – selbst in dichter Vegetation oder mitten in der Nacht. Solche Technologien könnten unsere Möglichkeiten, scheue Arten aufzuspüren, Beutebewegungen in Echtzeit zu kartieren und schnell auf neue Naturschutz-Herausforderungen zu reagieren, erheblich verbessern.
Die Beobachtung der Beuteverfügbarkeit bedeutet nicht einfach, Tiere zu zählen. Es geht darum, das Lebenselixier des Ökosystems zu verstehen. Mit Fotofallen, Spur- und Beutezählungen – und bald auch aus der Luft oder per Drohne – baut LEC ein vielschichtiges Bild davon auf, wie Raubtiere und Beutetiere zusammenleben. Dieses Wissen bleibt nicht in Berichten liegen: Es fliesst direkt in Schutzstrategien ein, unterstützt das Wildtier-Management und stellt sicher, dass sowohl Raubtiere als auch ihre Beute auch in Zukunft in der Kalahari bestehen können.