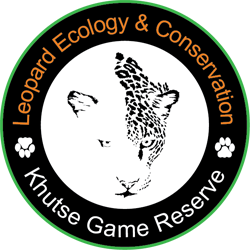Die Populationen von Leoparden und Löwen sind weit mehr als nur Zahlen. Sie sind lebendige, sich ständig verändernde Netzwerke, geformt durch Geburten, Todesfälle, Abwanderungen und neue Zusammenschlüsse. In der Kalahari stehen Löwen und Leoparden an der Spitze dieses Netzes – und ihre Populationsdynamik beeinflusst alles: vom Verhalten der Beutetiere bis hin zu den Vegetationsmustern. Zu verstehen, wie diese Grosskatzen leben, sich fortpflanzen und miteinander interagieren, ist entscheidend – sowohl für den Schutz der Arten selbst als auch für die empfindlichen Ökosysteme, die sie stabilisieren.
Bei Leopard Ecology & Conservation kombinieren wir modernste Technologie mit Feldforschung, um herauszufinden, wie sich Löwen und Leoparden an eine der härtesten Landschaften der Erde anpassen. Indem wir ihre langfristigen Populationsstrukturen und demografischen Daten untersuchen, können wir Herausforderungen früh erkennen, Schutzmassnahmen gezielt entwickeln und ein Zusammenleben mit den lokalen Gemeinschaften fördern.
Leoparden erforschen: die scheuen Jäger
Im Gegensatz zu Löwen sind Leoparden Einzelgänger und besonders schwer zu beobachten. Klassische Beobachtungsmethoden liefern nur Ausschnitte ihres Lebens und erfassen selten das grosse Ganze. Um dieses Bild zu vervollständigen, setzt LEC strategisch platzierte Fotofallen ein. Diese liefern Tausende von Bildern, die die Grundlage für unsere Populationsanalysen bilden.
Jeder Leopard hat ein einzigartiges Fleckenmuster – wie ein Fingerabdruck – und kann so eindeutig identifiziert werden. Die gesammelten Daten fliessen in sogenannte „Capture-Recapture“-Modelle ein, mit denen wir Populationsdichte, Überlebensrate und Nachwuchs ermitteln können. 2023 führte LEC eine der umfassendsten Leoparden-Erhebungen durch, die je in der Kalahari Botswanas gemacht wurden; 2025 folgte eine Wiederholung, um die Trends über die Zeit zu verfolgen.
Diese Langzeitdaten sind entscheidend. Durch den Vergleich mehrerer Jahre sehen wir, ob die Bestände stabil, wachsend oder rückläufig sind. Das hilft, auch feine Veränderungen zu erkennen – zum Beispiel sinkende Überlebensraten bei Jungtieren oder weniger Nachwuchs bei erwachsenen Tieren – beides frühe Warnzeichen für ökologische Probleme.
Doch diese Fotofallen liefern nicht nur Zahlen: Sie zeigen auch Verhalten. Aufnahmen dokumentieren Leoparden beim Beutemachen, beim Markieren ihrer Territorien oder bei seltenen Begegnungen mit anderen Raubtieren. Zusammengenommen ergeben diese Beobachtungen ein vielschichtiges Bild davon, wie Leoparden ihre Nische in einem hart umkämpften Ökosystem behaupten.

Löwen beobachten: die sozialen Spezialisten
Während Leoparden alleine leben, sind Löwen Rudeltiere. Ihre sozialen Strukturen stellen ganz andere Fragen an die Forschung. In der Kalahari, wo Ressourcen knapp und Territorien riesig sind, sind Rudel oft kleiner und flexibler als in den beutereichen Savannen.
Um Löwenpopulationen zu erfassen, nutzt LEC eine Kombination aus Spurenzählungen, GPS-Halsbändern und Langzeitbeobachtungen. Spurenzählungen – also das Aufspüren und Bestimmen frischer Fährten im Sand – sind eine schonende Methode, um die Anzahl und Verteilung von Löwen auf grosser Fläche abzuschätzen. Sie sind besonders effektiv in der offenen Landschaft der Kalahari, wo frische Spuren leicht zu erkennen sind.
Diese Daten werden ergänzt durch direkte Sichtungen sowie durch Wiederbeobachtungen von GPS-besenderten Tieren, sodass einzelne Individuen und ganze Rudel genau verfolgt werden können.

Die GPS-Daten sind besonders wertvoll, wenn es um die Demografie geht. Sie zeigen, wie viele Jungtiere geboren werden, wie viele überleben und wann sie ins Rudel integriert werden. Das ist entscheidend, denn die Überlebensrate der Jungen ist einer der wichtigsten Faktoren für die Stabilität einer Löwenpopulation. Daten aus dem Jahr 2024 haben gezeigt, dass das Überleben der Jungtiere eng mit dem Nahrungsangebot, mit Rivalitäten zwischen Rudeln und mit Konflikten mit umherstreifenden Männchen zusammenhängt.
Auch Zu- und Abwanderungen lassen sich so erkennen: Wann kommen neue Löwen in das Gebiet, wann verlassen sie es? Solche Bewegungen zeigen, wie gut die Population mit anderen Gebieten vernetzt ist. Gelingt es wandernden Männchen, sich einem neuen Rudel anzuschliessen, bringen sie wertvolle genetische Vielfalt ein. Ist die Abwanderung aber zu stark, kann die lokale Population instabil werden.
Einblicke in Populationsdynamik
Durch diese Kombination von Methoden kann LEC Zusammenhänge erkennen, die weit über einfache Kopfzählungen hinausgehen. So deuten Langzeitdaten darauf hin, dass die Leopardenpopulationen in der zentralen Kalahari relativ stabil sind – wenn auch leichte Schwankungen in der Überlebensrate von Jungtieren zeigen, wie verletzlich kleine Populationen in ressourcenarmen Gebieten sind.
Die Löwen zeigen ein komplexeres Bild: Rudel vergrössern oder verkleinern sich abhängig von den Regenzyklen und vom Nahrungsangebot. Junge Männchen durchlaufen eine riskante Phase, wenn sie ihre Geburtsrudel verlassen müssen – eine Phase, die die Rudelstruktur in der ganzen Region prägt. Diese Erkenntnisse machen deutlich: Raubtierpopulationen sind keine statischen Gebilde, sondern dynamische Systeme, die auf ökologische und soziale Veränderungen reagieren.
Bedeutung für den Naturschutz
Das Verständnis dieser Gruppendynamik hat direkte Auswirkungen auf den Naturschutz. Verlässliche Populationsschätzungen helfen Wildtiermanagern einzuschätzen, ob bestehende Schutzmassnahmen wirken oder ob neue Bedrohungen auftauchen. Das ist besonders wichtig in der Kalahari, wo Klimawandel, Landnutzung und Konflikte zwischen Mensch und Tier wachsenden Druck auf die Ökosysteme ausüben.
Die Daten aus Fotofallen und Spurenzählungen liefern Basiswerte, die in die regionale Planung einfliessen und sicherstellen, dass Schutzgebiete gross genug und gut miteinander verbunden sind, um stabile Populationen zu erhalten. Demografische Erkenntnisse aus GPS-Daten helfen zudem, Zeiten besonderer Verletzlichkeit zu erkennen – zum Beispiel, wenn Rudel mit jungen Löwen besonders gefährdet sind, in Konflikt mit Viehhaltern zu geraten.
Indem LEC wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Handlungsempfehlungen übersetzt, schlagen wir eine Brücke zwischen Forschung und praktischem Naturschutz.
Langfristige Perspektiven schaffen
Eine der grossen Stärken von LEC ist das langfristige Engagement. Populationsdynamiken lassen sich nicht durch kurze Momentaufnahmen verstehen. Indem wir Datensätze über Jahrzehnte pflegen, können wir natürliche Schwankungen von menschlichen Einflüssen unterscheiden. So lassen sich schleichende Bestandsrückgänge erkennen, bevor es zu spät ist.
Die Leopardenstudien von 2023 und 2025 sind ein gutes Beispiel: Durch regelmässig wiederholte, standardisierte Erhebungen können wir Veränderungen sicher feststellen und ein klareres Bild vom Gesundheitszustand der Population gewinnen. Ebenso haben Jahrzehnte der Löwenforschung gezeigt, wie sich Rudel an Dürren und an Schwankungen im Beuteangebot anpassen – Erkenntnisse, die weit über die Kalahari hinaus Bedeutung haben.

Die menschliche Dimension
Die Dynamik von Raubtierpopulationen ist eng mit den Menschen vor Ort verbunden. Wenn Löwen- oder Leopardenbestände in Weidegebiete vordringen, kommt es leicht zu Konflikten. Indem LEC Gruppengrössen, Abwanderungen und Nachwuchs überwacht, können wir vorhersagen, wo und wann solche Konflikte am ehesten auftreten. Dieses Wissen teilen wir mit den Bauern, damit sie rechtzeitig Schutzmassnahmen ergreifen können – so werden Verluste verringert und ein friedlicheres Zusammenleben gefördert.
Darüber hinaus zeigen diese Studien auch den kulturellen und ökologischen Wert der Raubtiere. Löwen und Leoparden sind mehr als Forschungsobjekte – sie sind Symbole der Wildnis und wichtige Bausteine im Gleichgewicht der Natur. Ihren Schutz zu sichern bedeutet, die Integrität des gesamten Kalahari-Ökosystems zu bewahren.